Aktuelle Beiträge

Die Mittelschicht zahlt, Superreiche nicht
Eine Länder-Studie zur tatsächlichen Besteuerung von Superreichen zeigt: Selbst Steuersumpf Schweiz besteuert Milliardäre stärker als Deutschland und Österreich. Mittelstandsfamilien haben in beiden Ländern höhere Steuer- und Abgabensätze als Milliardäre und Multimillionäre
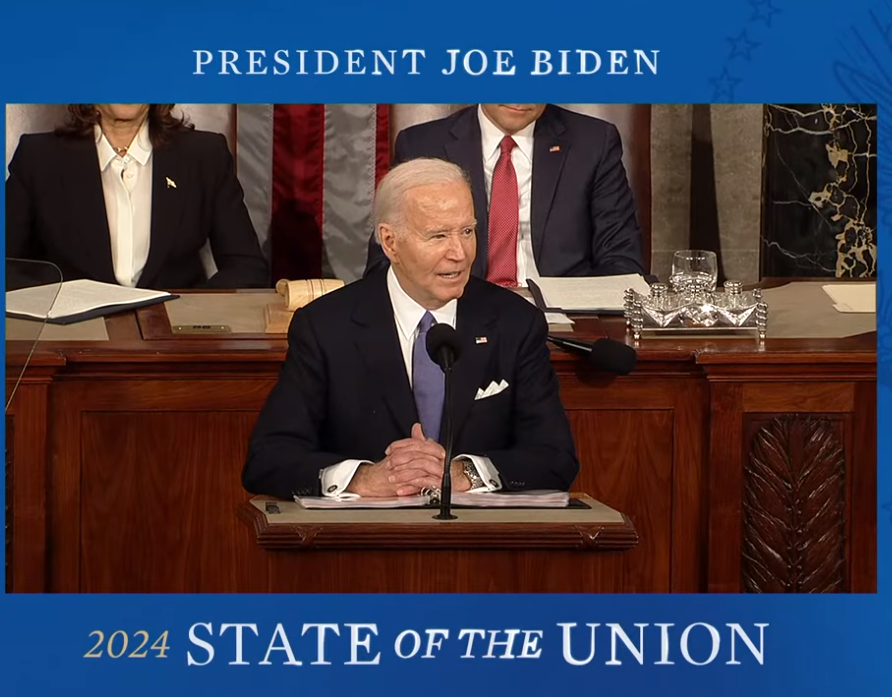
Gerechtigkeitscheck: Sonderausgabe zum Jahrbuch
Joe Biden zitiert das Jahrbuch Steuergerechtigkeit und die BMW-Erb*innen unterstreichen mit 1,4 Milliarden Steuerersparnis seine Kernbotschaft Richtig geraten: Es gibt

Gerechtigkeitscheck Februar – Revolution oder Reform?
Jeden Monat blicken wir auf steuerrechtliche und steuerpolitische Entwicklungen aus der Perspektive der Steuergerechtigkeit.

Das Ringen um Kinderfreibetrag und Kindergeld
Christian Lindner plant noch in diesem Jahr, den Kinderfreibetrag zu erhöhen, ohne dabei das Kindergeld erneut anzupassen. Das steht jedoch Vereinbarungen des Koalitionsvertrags entgegen.
Aktuelle Publikationen
UmSTEUERungspotenzial von 75 Milliarden Euro – Jahrbuch Steuergerechtigkeit 2024
Berlin, 06.03.2024. UmSTEUERungspotenzial von 75 Milliarden Euro; Deutsches Steuersystem braucht Update. Deutschland ist Hochsteuerland für Menschen, die für ihr Geld

Jahrbuch Steuergerechtigkeit 2024
UmSteuerungspotenzial von 75 Milliarden Euro; Deutsches Steuersystem braucht Update. Deutschland ist Hochsteuerland für Menschen, die für ihr Geld arbeiten, aber

Digitalkonzerne fair besteuern
Booking.com, Microsoft und Alphabet verschieben den Großteil ihrer Gewinne trotz der Bemühungen der OECD und G20 weiter in Steueroasen und zahlen dadurch weniger Steuern als die kleinen und mittelständischen Unternehmen von nebenan. Mehr dazu in der aktuellen Studie…

Übergewinne richtig besteuern
Allein die zehn größten Mineralölkonzerne haben ihre Gewinne im Krisenjahr 2022 um 320 Milliarden US-Dollar gesteigert. Nur etwa zwei Prozent davon wurde durch die EU-Übergewinnsteuer abgeschöpft. Mit einer allgemeingültigen Übergewinnsteuer könnte Deutschland von den 200 größten und profitabelsten Konzernen pro Jahr bis zu 40 Milliarden Euro mehr einnehmen.
